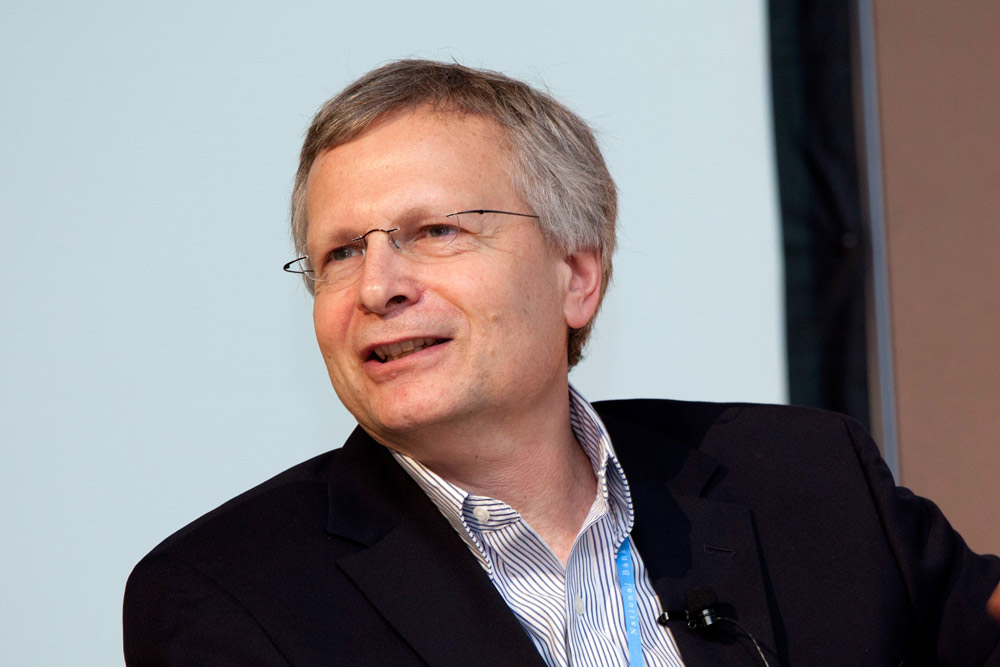Im Laufe der letzten dreißig Jahre setzte sich eine negative Globalisierug durch, bei der die VerliererInnen vergessen gingen. Das rächt sich jetzt, sagt der Harvard.Ökonom Dani Rodrik im Interview mit der schweizerischen Online-Publikation „Republik“ – und fordert offene Grenzen für Arbeitskräfte.
«Wir haben die Verlierer der Globalisierung vergessen»
Dani Rodrik ist einer der wichtigsten Ökonomen unserer Zeit. Der Harvard-Professor geht hart mit seiner Zunft ins Gericht: Viel zu lange hätten Ökonomen und Politiker das Dogma des ungehemmten Freihandels nachgebetet. Und dabei eine populistische Revolte provoziert.
Von Mark Dittli (Interview)
Freier Handel ist gut. Je offener die Grenzen für Güter und Kapital sind, desto besser. Der Wohlstand für alle steigt, wenn sich Staaten auf die Produktion jener Güter konzentrieren, bei denen sie komparative Kostenvorteile besitzen, und wenn die Staaten untereinander Handel treiben. So ungefähr lautet, stark vereinfacht ausgedrückt, eine der wichtigsten Grundlagen der Ökonomie.
Diese Annahme ist falsch, sagt Dani Rodrik. Beziehungsweise: Sie ist unvollständig. Grenzüberschreitender Handel produziere innerhalb einzelner Staaten immer Sieger und Verlierer – und es sei Aufgabe der Politik, die Gewinne zu verteilen. Doch genau diese Aufgabe sei in vielen westlichen Industrienationen in den letzten drei Jahrzehnten sträflich vernachlässigt worden, mahnt der 60-jährige Harvard-Professor.
Dani Rodrik ist in der Türkei aufgewachsen. Sein Vater fabrizierte Kugelschreiber – «das konnte er nur erfolgreich tun, weil die Türkei die junge heimische Industrie mit Importzöllen schützte», sagte Rodrik später in Interviews – und wurde damit vermögend genug, dass der Sohn 1975 an der Harvard University in Cambridge, Massachusetts, studieren konnte.
Er kehrte nicht mehr zurück. Nach Abschluss seiner Studien in politischer Ökonomie in Harvard und Princeton stieg er 1985 in die universitäre Lehre ein. Abgesehen von einem Intermezzo an der Columbia University in New York blieb er dabei Harvard treu: Heute hält Rodrik den Ford Foundation Lehrstuhl für internationale politische Ökonomie an der John F. Kennedy School of Government in Harvard. Seine türkische Staatsbürgerschaft hat er bis heute behalten.
Zum Paria seiner Zunft wurde er 1997 mit seinem Buch «Has Globalization Gone Too Far?». Darin wirft er die Frage auf, ob die seit den frühen 1990er-Jahren betriebene Form der Hyperglobalisierung in der Weltwirtschaft mehr Schaden als Nutzen angerichtet hat. Weitere wichtige, lesenswerte Werke von Rodrik sind «The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy» (2011), «Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science» (2015) und zuletzt «Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy».
Herr Rodrik, Präsident Trump hat Strafzölle gegen Güter aus China erhoben, China hat mit ähnlichen Massnahmen zurückgeschlagen. Stehen wir am Beginn eines Handelskrieges?
Nein, das ist noch kein Handelskrieg. Die Ängste sind übertrieben. Trump fühlte sich wohl gezwungen, rund um das Handelsthema bei seiner Wählerbasis endlich einmal Stärke zu demonstrieren. Aber ich denke, er bellt bloss. Er wird nicht beissen. Die einflussreichen amerikanischen Grosskonzerne sind enorm stark im internationalen Handel verflochten, das wird den Spielraum für Trump limitieren. Die Gegenparteien in China und in Europa werden jetzt ebenfalls Härte und Entschlossenheit demonstrieren, doch im Grunde wissen sie, dass Trump nur bellt.
Trump spielt also hauptsächlich mit der Symbolik?
Genau. Er denkt politisch; er will Stärke zeigen, einen symbolischen Gewinn einfahren und sich dann anderen Themen widmen. Je mehr die Medien von «Handelskrieg» sprechen, desto mehr helfen sie ihm, denn genau mit dieser martialischen Symbolik will er punkten. Es gibt in seiner Administration natürlich Leute, die das internationale Handelssystem grundsätzlich verändern, ja zerschlagen wollen, beispielsweise Trumps Berater Peter Navarro oder Robert Lighthizer, der Handelsbeauftragte des Weissen Hauses. Aber der Präsident verhält sich bei volkswirtschaftlichen Fragen wie mit allem anderen, was er tut: Er interessiert sich nicht für die komplexen Themen. Er denkt an die Symbolik, mehr nicht. Was wir in Sachen Protektionismus bis jetzt gesehen haben, beunruhigt mich nicht. Ronald Reagan etwa fuhr in den frühen 1980er-Jahren viel härteres Geschütz auf, als er die Japaner und Europäer zu «freiwilligen» Exportbeschränkungen zwang.
Sie haben kürzlich geschrieben, Reagans damalige Politik sei gar nicht so schädlich gewesen, weil sie dazu diente, in der US-Bevölkerung politischen Dampf abzulassen. Wird das mit Trumps Massnahmen ähnlich sein?
Das bezweifle ich. Trump hat wahrscheinlich zu viel versprochen mit seiner protektionistischen Rhetorik. Am Ende werden viele seiner Wähler enttäuscht sein. Die Zölle helfen den Arbeiterschichten in den strukturschwachen Bundesstaaten nicht. Wäre es Trump wirklich an deren Wohl gelegen, hätte er andere Mittel wählen können, um ihnen zu helfen.
Trump hat schon als Präsidentschaftskandidat heftig gegen den Freihandel politisiert. Wieso ist diese Botschaft in seiner Wählerbasis auf dermassen fruchtbaren Boden gefallen?
Wir haben ab den 1990er-Jahren weltweit eine zweifelhafte Form von Globalisierung vorangetrieben, ich nenne sie die Hyperglobalisierung. Der Freihandel wurde kaum mehr infrage gestellt, es galt die Maxime «Je mehr, desto besser». Auch unter uns Ökonomen galt es als Häresie, den ungehemmten Freihandel und die grenzüberschreitende Integration der Weltwirtschaft zu kritisieren. Das war ein grosser Fehler, denn niemand hat sich um die Verlierer der Globalisierung gekümmert. Nun erhalten wir die Quittung dafür, in Form einer populistischen Revolte.
Was ist denn falsch an der Theorie des grenzüberschreitenden Handels, wonach es für einzelne Länder besser ist, sich auf ihre Stärken zu fokussieren und andere Güter von Handelspartnern zu beziehen?
Nichts. Aber es war stets unbestritten, dass Freihandel in einzelnen Staaten über Arbeitsplatzverluste und Lohndruck auch Verlierer produziert. Selbst wenn der volkswirtschaftliche Kuchen als Ganzes grösser wird – und das wird er –, können diese Verliererschichten nicht ohne weiteres in andere Branchen ausweichen. Freihandel führt immer zur Frage, wie die Gewinne zwischen Siegern und Verlierern verteilt werden. Darum müssen sich die Politiker kümmern. Doch das haben sie, besonders in den USA, nicht getan. Stattdessen galt in der Politik wie in der ökonomischen Lehre die dogmatische Vorstellung des «Trickle-down»-Effekts, dass also die Gewinne der Globalisierung auf alle Bevölkerungsschichten rieseln. Das war naiv und falsch.
Der freie Markt regelt das nicht allein?
Nein, das kann er nicht. Der freie Markt ist für die Marktwirtschaft im übertragenen Sinn etwa das, was Zitronensaft für Limonade ist. In purer Form ist Zitronensaft kaum geniessbar. Wenn Sie eine trinkbare Limonade herstellen wollen, müssen Sie den Zitronensaft im richtigen Verhältnis mit Wasser und Zucker mischen. Das wäre dann der Staat. Es ist völlig klar, dass der Staat eine aktive Rolle spielen muss, um die Folgen der Globalisierung in der Bevölkerung abzufedern.
Wieso hat diese populistische Revolte genau jetzt stattgefunden?
Seit den späten 1980er-Jahren ist in vielen westlichen Ländern ein schleichender Anstieg der Zustimmungsraten für populistische Parteien zu beobachten. Der Druck wuchs stetig. Eine Mischung aus mehreren Faktoren führte dazu, dass die populistische Revolte jetzt ausgebrochen ist: Die Hyperglobalisierung; technologische Fortschritte, die ebenfalls ökonomische Ängste schüren; die Finanzkrise von 2008 und die politischen Massnahmen danach, die eher den grossen Banken als den normalen Menschen auf der Strasse dienten. In Europa ging man zudem fürchterlich falsch mit der Eurokrise um, die Austeritätspolitik war schädlich. Wir können die einzelnen Faktoren nicht gewichten, aber ihre Mischung bot den idealen Nährboden für populistische Parteien, um mit den Ängsten der Bevölkerung zu spielen.
Wie kommt es, dass sich diese populistische Revolte hauptsächlich im rechten Spektrum, im konservativ-nationalistischen Lager abspielt?
So einfach kann man das nicht sagen. Auch Linkspopulisten haben in den vergangenen Jahren starken Auftrieb erhalten, vor allem in Lateinamerika und Südeuropa. Die Gemeinsamkeit ist, dass es den Politikern in beiden Extremen gelingt, die ökonomischen Ängste der Bevölkerung auszuspielen. In Staaten, die besonders unter den Auswirkungen der internationalen Kapitalströme und unter Finanzkrisen gelitten haben und in denen Einkommen und Vermögen besonders ungleich verteilt sind, richtet sich die Wut der Bevölkerung tendenziell gegen die eigene Wirtschaftselite. Dieses Umfeld hilft den Linkspopulisten, beispielsweise in Griechenland, Spanien oder Lateinamerika. In Ländern wie Frankreich, Grossbritannien, Deutschland oder den Niederlanden entladen sich die ökonomischen Ängste dagegen nicht primär an der eigenen Wirtschaftselite, sondern an Immigranten und generell am Fremden. Deshalb sind dort die Rechtspopulisten im Aufwind.
Und in den USA?
Die USA sind ein interessanter Fall, weil wir dort beide Phänomene sehen. Die Ökonomen David Autor, David Dorn und Gordon Hanson haben 2016 überzeugend nachgewiesen, wie sich die Wählerschichten in den USA nach dem «China-Schock», also der Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation WTO, immer mehr radikalisiert haben. Und zwar in beide Richtungen. Republikaner wurden konservativer, Demokraten wurden, im amerikanischen Sinn, liberaler. Das zeigte sich auch in den letzten Präsidentschaftswahlen, als sich die Wut und die Ängste der Amerikanerinnen und Amerikaner sowohl an Ausländern als auch an der eigenen Wirtschafts- und Finanzelite entlud. Trump symbolisierte das eine Extrem, Bernie Sanders das andere.
Die Globalisierung hat in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg stetig zugenommen. Ab wann lief sie aus dem Ruder?
Ich sehe zwei entscheidende Wegmarken in den frühen 1990er-Jahren, als die Globalisierung in eine schädliche Hyperglobalisierung umschlug. Erstens der Abschluss der Uruguay-Handelsrunde von 1994, die im Folgejahr zur Etablierung der Welthandelsorganisation WTO führte. Damit begann ein neues Handelsregime. Zuvor, im GATT-System der General Agreements on Tarriffs and Trade, ging es effektiv um den Abbau von Handelszöllen. Das war durchaus sinnvoll, denn der ökonomische Nutzen eines Abbaus hoher Zölle ist gross. Unter dem WTO-Regime ging es dann aber immer mehr um den Abbau von sogenannten nicht tarifären Handelshemmnissen. Es ging um die Gleichschaltung von inländischen Regulierungen, um Harmonisierung, um das Verbot von Subventionen, den Schutz von Investoren und von intellektuellem Eigentum und dergleichen. Unter der WTO wurde die Maximierung des internationalen Handels zum erklärten Ziel. Dabei ging die Frage vergessen, ob dies für einzelne Länder auch sinnvoll ist, denn der volkswirtschaftliche Grenznutzen dieser Art von Freihandelsabkommen wurde immer geringer.
Und was ist die andere Wegmarke?
Die Globalisierung der Kapitalströme. Mächtige Organisationen wie der Internationale Währungsfonds und die OECD verschrieben sich der Ideologie, dass die Kapitalströme liberalisiert werden müssen. Länder mussten ihre Kapitalbilanzen öffnen; was zuvor die Ausnahme war, wurde zur Norm. Damit entstand eine schiefe Form der Globalisierung, die primär den multinationalen Konzernen und Grossbanken diente. Eine Folge davon war auch die grössere Krisenanfälligkeit des Weltfinanzsystems, was sich beispielsweise 1997 in Asien, 1998 mit Russland oder 2008 weltweit zeigte.
Gleichzeitig half diese Hyperglobalisierung aber vor allem in Asien, Hunderte Millionen Menschen aus der Armut zu befreien und in den Mittelstand zu heben. Was war denn daran schlecht?
An sich nichts. Aber die grössten wirtschaftlichen Fortschritte in Asien geschahen eben genau nicht unter dem Regime der Hyperglobalisierung. Das beste Beispiel ist China, dessen Entwicklung alles andere in den Schatten stellt, weil sie tatsächlich mehrere hundert Millionen Menschen aus der Armut befreite: China spielte nicht mit den Regeln der WTO, sondern mit den Regeln, wie sie zu GATT-Zeiten und dem System von Bretton Woods nach dem Zweiten Weltkrieg üblich waren. China hat die Kapitalflüsse nicht liberalisiert, Peking subventionierte und schützte heimische Industrien, wo es nur ging, China kümmerte sich nicht um den Schutz von geistigem Eigentum und die Rechte ausländischer Investoren. Genau so hatten zuvor auch Japan, Korea und Taiwan den Sprung nach oben geschafft.
Und Sie denken, das hätte mit den Regeln der Hyperglobalisierung nicht funktioniert?
Nein. Nehmen Sie Mexiko als Beispiel. Mexiko hat nach 1994 alles getan, was die herrschende ökonomische Ideologie verlangte: Mexiko öffnete die Grenzen für Kapital und Güter, hat seine heimische Industrie liberalisiert, Staatsbetriebe privatisiert und so weiter. Das Resultat? Gemessen am Pro-Kopf-Einkommen hat sich Mexiko über 25 Jahre enttäuschend entwickelt. Das meine ich nicht bloss im Vergleich mit asiatischen Staaten, sondern auch im Vergleich mit anderen Ländern in Lateinamerika. Das sagt einiges.
Würden Sie empfehlen, diese Form der Hyperglobalisierung rückgängig zu machen?
Zunächst ist nur schon mal wichtig, dass Ökonomen und Politiker nüchtern darüber diskutieren, dass freier Handel nicht nur Gewinner, sondern eben auch Verlierer produziert. Dass Freihandel nicht das Ziel per se sein kann. Und dass Freihandel zwangsläufig Fragen der Umverteilung mit sich zieht. Regierungen, die sich diesen Fragen nicht stellen, laufen Gefahr, dass sich die benachteiligten Bevölkerungsschichten eines Tages gegen sie wenden. Übrigens wurde die Diskussion auch nie wirklich ehrlich geführt. Wollte man tatsächlich einen für die ganze Weltwirtschaft signifikanten zusätzlichen ökonomischen Nutzen schaffen, sollte man die Grenzen nicht für Kapital und Güter noch weiter öffnen, sondern dort die Hürden senken, wo sie weitaus am höchsten sind: bei den Arbeitskräften.
Sie empfehlen, die Grenzen für Arbeitskräfte weiter zu öffnen?
Ich sage nur, dass dort die weitaus grössten volkswirtschaftlichen Gewinne zu erzielen wären und dass die ehrlichen Verfechter des Freihandels dort ansetzen müssten. Wenn beispielsweise ein Mann aus Pakistan mit einem fix auf drei oder fünf Jahre befristeten Vertrag in Deutschland Jobs verrichten kann, für die in Deutschland eine Knappheit an Arbeitskräften herrscht, wäre das für beide Staaten ein grosser ökonomischer Gewinn. Es ist mir natürlich völlig klar, dass derartige Vorschläge im aktuellen politischen Klima wenig Chancen haben. Mittelfristig müssen wir uns aber nüchtern darüber unterhalten.
Zurück zu meiner Frage: Was in unserem heutigen globalen Handelssystem sollte rückgängig gemacht werden?
Die Norm, dass die Grenzen für Kapitalflüsse komplett offen sein müssen. Das war ein Fehler, und es hat nachweislich die Häufigkeit internationaler Finanzkrisen erhöht. Zweitens sollten Dinge wie der Schutz von Investoren, von geistigem Eigentum und das Verbot von Subventionen nicht Teil von Freihandelsabkommen sein. Es kann für Schwellenländer sehr wohl angebracht sein, ausgewählte heimische Industrien mit Subventionen zu schützen. Das sollte ihnen auch erlaubt sein.
Können einzelne Staaten denn überhaupt aus diesem System ausscheren? Würden sie nicht sofort von den Finanzmärkten abgestraft, wenn sie beispielsweise Kapitalverkehrskontrollen einführten?
Die Finanzmärkte haben keine Ideologie. Wenn Kapitalverkehrskontrollen Teil einer nachvollziehbaren Strategie sind, um im betreffenden Staat bessere Bedingungen für die Wirtschaft zu schaffen, wenn sie also Teil eines langfristig überzeugenden Wachtsumsnarrativs sind, dann sollten sie langfristig denkende Investoren nicht abschrecken. Nur die kurzfristig ausgerichteten Spekulanten wären verärgert, aber davon sollte sich eine Regierung nicht einschüchtern lassen.
Aber Unternehmen könnten mit Abwanderung drohen und Arbeitsplätze abbauen.
Ich halte das oft für einen Bluff. Und es ist eine allzu einfache Entschuldigung für Politiker, nichts zu tun, weil ansonsten angeblich die Unternehmen abwandern würden. Ich denke, das ist in vielen Fällen eine Form von finanzieller und kognitiver Befangenheit: Die Politiker haben in den vergangenen 30 Jahren so oft die Drohung gehört, dass die Unternehmen abwandern könnten, wenn die Grenzen nicht völlig offen für Güter und Kapital sind, dass sie nun selbst daran glauben. Sehen Sie nur, wie sich die Staaten seit Jahren gegenseitig in der Besteuerung von Unternehmensgewinnen unterbieten, bloss weil sie glauben, die Firmen könnten sonst abwandern: Das ist Irrsinn!
Sie glauben wirklich, dahinter steht grösstenteils ein Bluff?
Ja. Und eine verkehrte, einseitig ausgelegte Ideologie, die unsere Gesellschaften beschädigt hat. Nur gesunde, intakte Gesellschaften schaffen langfristig volkswirtschaftliches Wachstum. Wir brauchen wieder gesunde Nationalstaaten mit gesunden Gesellschaften. Ich mache mir grosse Sorgen um die Erosion der demokratischen Normen in Staaten wie den USA, Grossbritannien, Italien oder Frankreich. Oder diese Verlockung, dieser Flirt mit dem Autoritären, der in vielen Staaten zu beobachten ist. Das macht mir Angst. Ich fürchte, die Ökonomen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass es überhaupt so weit gekommen ist.